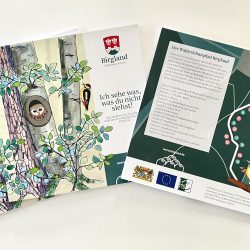Walderlebnispfad Birgland
Fitness und Naturerleben
Die Gemeinde Birgland hat 2023 einen Walderlebnispfad an einem Teilstück des Birglandrundwanderwegs an der Hohen Straße in Schwenderöd errichtet – direkt gegenüber vom Pendlerparkplatz. Daran grenzt das Waldgebiet der Familie Müller in Leinhof an, die es sich hier zur Aufgabe gemacht hat, die dort bestehende Fichtenmonokultur sukzessive durch einen nachhaltigen und widerstandsfähigen Mischwald zu ersetzen.
Der Walderlebnispfad greift dabei mehrere Aspekte auf: Er gibt in knapper Form wichtige Informationen über den Wald, lädt auf spielerische Weise ein, zu beobachten, was in der Natur passiert und vermittelt Freude über die eigenen körperlichen Fähigkeiten an verschiedenen Fitnesstationen.
Maskottchen
Als Maskottchen, die die BesucherInnen begleiten, wurden ein Waldkauz und ein Specht, beide in diesem Wald heimische Vogelarten, ausgesucht. Rico Dornbach hat sie gezeichnet, Stephan Böhm hat sie als Grafik digitalisiert.
Malbuch und Maltutorials zum Thema
Die beiden Maskottchen begleiten die BesucherInnen auf dem Weg und thematisieren Pflanzen und Naturerscheinungen mit dem alten Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Zu den Abbildungen auf den Tafeln gibt es ein Malbuch, in dem die Geschichte und alle Bilder als Vorlagen zum Ab- oder Ausmalen in einfacher Form dargestellt werden. Die Illustrationen und die Geschichte dazu hat Künstlerin Evi Steiner-Böhm erstellt. Sie können ausgedruckt und z.B. für den Unterricht verwendet werden.
Die Stationen
Insgesamt gibt es 15 Stationen. Acht Stationen laden dazu ein, körperliche Fähigkeiten wie Balancieren, Hanteln oder Klettern auszuprobieren. An sieben weiteren Stationen sind Tafeln aufgestellt, auf denen die beiden Maskottchen das alte Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielen. Dabei thematisieren sie die Besonderheiten oder Neuheiten des Waldes.
- Station 1: Ahorn und Vogelkirsche
- Station 2: Auf-und-Ab Balancierstrecke
- Station 3: 2-Stufen-Reck
- Station 4: Moose
- Station 5: Einfache Balancierstrecke
- Station 6: Jurakalkstein und Tanne
- Station 7: Hohes Reck
- Station 8: Klimawald
- Station 9: Bewegliche Balancierstrecke
- Station 10: Hüpfpilze
- Station 11: Douglasie
- Station 12: Kletterbaum
- Station 13: Linde und Elsbeere
- Station 14: Stufenreck
- Station 15: Natürliche Verjüngung des Waldes
Hintergrundinformationen für Schulen und Gruppen
Die Gegend
Die Gemeinde Birgland liegt im Oberpfälzer Jura, einem Teil des Fränkischen Jura. In der Zeit des Jura lag vor etwa 161 bis 150 Millionen Jahren ganz Süddeutschland im Bereich eines Flachmeeres. Die Ablagerungen dieses Meeres bilden heute den größten Anteil der Gesteine, im Wesentlichen Kalkstein, und sind Grundmaterial der Fränkischen Alb. Durch Hebungen der europäischen Kontinentalplatte gegen Ende des Oberen Jura zog sich das Meer zurück und größere Flächen wurden zu Beginn der folgenden Kreidezeit zunächst Festland. Während dieser Zeit herrschte tropisches Klima und es kam zu einer intensiven Verwitterung der vorher entstandenen Kalk- und Dolomitgesteine.
Die Fränkische Alb ist deshalb reich an schönen Felsen, Höhlen, Dolinen, Karstquellen und steinernen Rinnen. Sie wird von einigen tief eingeschnittenen Flüssen und Bächen und von Trockentälern durchzogen. (Quelle: Wikipedia)
Klimawald
Ein gesunder Wald ist ein fein aufeinander abgestimmtes System, das nicht nur Pflanzen und Tieren ihren Lebensraum gibt, sondern auch Sauerstoff produziert und große Mengen Wasser speichert. Er filtert schädlichen Staub und giftige Gase aus der Luft und kann Temperaturschwankungen ausgleichen. Er verhindert, dass der Wind den Boden abträgt und schützt vor Steinschlägen und Lawinen. Und er bindet das CO2, das dazu beiträgt, dass die Atmosphäre sich aufheizt.
Man hat in den letzten 20 Jahren viel geforscht, um herauszufinden, wie man den Wald besser schützen kann. Die Forschungen haben ergeben, dass Mischwälder, in denen die Baumarten sich gegenseitig ergänzen, am wenigsten anfällig für Trockenheit oder Schädlinge sind. Durch die Gemeinschaft sind sie besser mit Wasser und vielfältigen Nährstoffen versorgt. Dass gesunde Mischwälder zudem noch mehr CO2 speichern, also dazu beitragen, den Klimawandel zu mildern, macht sie auch zu wichtigen Bausteinen für eine nachhaltige Zukunft. Die Bayerischen Staatsforsten haben deshalb in den letzten Jahren nicht nur in den eigenen Beständen Millionen von Bäumen gepflanzt, um den Staatswald nachhaltig umzubauen. Auch private Waldbesitzer, die ihre Wälder von der herrschenden Monokultur zu gesunden Mischwäldern umbauen, erhalten Förderungen für den Ankauf von Setzlingen.
Wichtige Baumarten im Klimawald
Neben einer guten Durchmischung von Nadelbäumen und Laubbäumen geht es im Klimawald auch darum, einheimische Baumarten (wieder-) anzupflanzen, die bereits optimal an den Standort angepasst sind. Dazu gehören bei den Nadelhölzern neben Fichte, Lärche und Kiefer auch Tannen, Douglasien oder Eiben, bei den Laubhölzern Buchen, Hainbuchen, Linden, Eichen und Birken sowie Ahorn, Vogelkirsche, Mehlbeere und Elsbeere.
Die folgenden Informationen sind entnommen von www.wald.de.
Nadelbäume
Fichten sind immergrün und werden ca. 20 bis 60 m hoch. Ihr Wuchs ist kegelförmig, die Nadeln sind lang und spitz und wachsen spiralförmig an den Ästen. Die länglichen Zapfen hängen an den Ästen. Fichten sind Flachwurzler und anspruchslos in der Ernährung. In trockenen Jahren sind sie anfällig für den Borkenkäfer, da sie dann nicht genug Harz produzieren können, um ihn unschädlich zu machen.
Kiefern sind immergrün und werden ca. 15 – 40 m hoch. Die Krone ist kegel- oder schirmförmig. Die Nadeln wachsen meist in Bündeln mit bis zu acht Nadeln zusammen, die Zapfen sind rundlich bis eiförmig. Gut erkennbar auch an der rötlichen, sehr borkigen Rinde.
Tannen sind immergrüne Nadelhölzer und werden zwischen 40 und 70 m hoch. Der Wuchs ist gerade, die beliebte schöne Kegelform entsteht durch regelmäßige Etagen mit horizontalen Ästen. Die Nadeln sind flach und sitzen direkt an den Ästen. Die Zapfen stehen aufrecht auf den Zweigen und fallen nicht ab. Vielmehr öffnen sie sich und lassen ihre geflügelten Samen frei. Dabei verlieren sie ihre Schuppen und fallen auseinander. Deshalb findet man keine Tannenzapfen auf dem Boden. Für die Klimawälder werden die verschiedensten Tannenarten eingesetzt.
Douglasien sind immergrün und werden ca 50 bis 60 m hoch. Die kegelförmige Krone ist relativ schmal. Die Nadeln wachsen rund um die Triebe und sind im Vergleich zu Tannennadeln recht weich. Die Zapfen sind länglich oval. Eine Besonderheit ist die Rinde mit vielen Harzbeulen und der Zitronengeruch der zerriebenen Nadeln. Sie war ursprünglich auch in Europa beheimatet, starb dann aber aus und überlebte in Nordamerika.
Lärchen sind sommergrün und werden ca. 35 – 40 m hoch. Die Wuchsform ist schlank und kegelförmig. Die Nadeln wachsen an Kurztrieben in mit 20 bis 40 rosettenförmig angeordneten Büscheln. Im Herbst fallen sie ab, wobei die Blattbasis am Zweig stehen bleibt. Die Zapfen stehen aufrecht eiförmig auf den Zweigen.
Eiben sind immergrün und werden ca. 10 -12 m hoch. Sie wachsen kegelförmig, im Alter wird die Krone ei- bis kugelförmiger, häufig sind sie mehrstämmig. Die Nadeln sind zugespitzt und leicht glänzend, sie wachsen an den Seitenzweigen 2-reihig, an aufrechten Zweigen schraubig stehend.
Männliche Blüten sitzen in kleinen kugeligen Kätzchen an den Zweigspitzen, aus den weiblichen Blüten entwickeln sich Scheinbeeren mit einem Samen in einer leuchtend roten Schale. Bei Eiben sind alle Pflanzenteile (außer den roten Schalen) für Menschen und Tiere hochgiftig!
Laubbäume
Bei uns wächst meistens die Gemeine Buche oder Rotbuche. Buchen sind sommergrün, erreichen eine Wuchshöhe von ca. 30 m. Die länglichen Blätter sind seidig behaart. Die Rinde ist grau und relativ glatt. Die Früchte der Buchen, die Bucheckern sind nicht nur für Vögel oder Eichhörnchen sondern auch für Menschen hochwertige, vielseitige Nahrungsmittel. Allerdings sind sie in rohem Zustand leicht giftig. Durch Rösten oder in heißem Wasser Abbrühen verlieren sie den Giftstoff.
Hainbuchen gehören trotz ihres Namens zu den Birkenarten. Sie werden bis zu 30 m hoch und erreichen einen Stammdurchmesser bis zu einem Meter. Sie gedeihen am besten auf gut wasserversorgten Lehm- und Tonböden. Ihre besondere Bedeutung liegt in der guten Schattenverträglichkeit, ihrer leicht zersetzbaren Streu und ihrer Schutzfunktion für andere junge Bäume, wie etwa Eichen. Die Blätter sind eiförmig und bleiben im abgestorbenen Zustand fast den ganzen Winter über an den Zweigen hängen.
Bei uns wachsen meistens Sommer- und Winterlinden. Linden sind sommergrün und werden zwischen 30 und 40 m hoch. Die Wuchsform ähnelt einem Herz. Ebenso sind die Blätter herzförmig und bei der Winterlinde etwas kleiner als bei der Sommerlinde. Die Blüten hängen in Gruppen mit bis zu 12 Blüten an Rispen und sind für ihre Heilwirkung bekannt (Lindenblütentee). Auch für Bienen sind sie eine wichtige Nahrungsquelle. Lindenholz ist sehr weich und ist deshalb bei Schnitzern besonders beliebt.
Eichen sind sommergrün mit einer Wuchshöhe von bis zu 40 m und sind neben der Rotbuche die zweithäufigste Laubbaumgattung in Deutschland. Bei uns wachsen meistens Stieleiche und Traubeneiche. Die Blätter haben an beiden Seiten zwischen 5 und 7 dreieckige, gerundete Lappen, die ziemlich symmetrisch angeordnet sind. Die Früchte der Eiche, die Eicheln, sind in rohem Zustand giftig, wenn man die Gerbstoffe allerdings auswäscht, erhält man ein hochwertiges Nahrungsmittel. Eichen sind anspruchslos und robust, sie vertragen auch sommerliche Trockenzeiten und Extremstandorte.
Birken-Arten sind sommergrüne Bäume oder Sträucher. Sie können bis zu 30 m hoch werden. Bei vielen Birken-Arten ist die Borke besonders auffällig, ihre Farbe reicht von fast schwarz über dunkel- und hellbraun bis weiß. Die spitz zulaufenden Blätter sind wechselständig, meist zweireihig an den Zweigen angeordnet. Die Blattränder sind je nach Art gezackt oder wellig. Die Blütenstände hängen in kleinen Gruppen meist an den Enden der Zweige.
In Deutschland sind hauptsächlich drei Ahornarten heimisch: Der Spitzahorn, der Bergahorn, und der Feldahorn. Alle drei sind sommergrün und unterscheiden sich vor allem durch ihre Höhe und die Form ihrer Blätter. Der Spitzahorn wird bis zu 35 m hoch, seine Blätter sind 5-7-lappig und bogig gezähnt. Der Bergahorn wird ca. 30 m hoch, seine Blätter sind 5-lappig mit gesägten Rändern, der Feldahorn wird nur ca. 15 m hoch und seine Blätter sind 5-lappig mit glatten Rändern, wobei die drei oberen Lappen wesentlich größer sind.
Elsbeeren sind sommergrün und erreichen Wuchshöhen von 15 bis 25 Metern. Die Borke ist bei älteren Bäumen häufig aschgrau. Die wechselständig an den Zweigen angeordneten Blätter sind eiförmig und 3 bis 5-lappig, der Blattrand unregelmäßig gesägt. Die kleinen Apfelfrüchte der Elsbeere wurden früher häufig gesammelt, heute sind sie vor allem für Vögel eine wichtige Nahrungsquelle. Die Elsbeere kommt auch mit trockenen Standorten gut zurecht. Sie wächst langsam und hat ein elastisches, rötliches und sehr wertvolles Holz.
Mehlbeeren sind sommergrün und werden ca. 6-10 m hoch. Sie haben einen geraden Stamm und eine sehr gleichmäßige, meist flach gewölbte Krone. Die Blätter sind breit keilförmig und vorne kurz zugespitzt. Die weißen Blüten stehen in zusammengesetzten halbkugeligen Scheindolden zusammen, im Herbst reifen sie zu kleinen rötlichen Apfelfrüchten. Die Mehlbeere ist ein Tiefwurzler und eignet sich deshalb auch für heiße und trockene Standorte.

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)